Fachbregriff suchen
Abdomen
Bauch, Unterleib. Der Rumpfbereich zwischen Brustkorb und Becken.
Achillotenotomie
Durchtrennung und Verlängerung der Achillessehne.
Adaption
Anpassungsvermögen von Organen, zum Beispiel des Auges an verschiedene Helligkeitsgrade.
Affektivität
Die Gesamtheit der Stimmungen. Gefühle, Affekte und die allgemeine Erregbarkeit eines Menschen: ein wichtiger Aspekt der Persönlichkeitsforschung und –diagnostik.
Ageusie
Verlust des Geschmacksinns
Agnosie
ein Gegenstand wir nicht „erkannt“, obwohl man nicht blind ist (visuelle Agnosie oder Seelenblindheit oder Objektagnosie), obwohl man nicht taub ist (akustische Agnosie oder Seelentaubheit); man kann Körperteile nicht richtig benennen (Körperagnosie) oder speziell die Finger nicht unterscheiden (Fingeragnosie). Manche halten sich für gesund, obwohl sie krank sind (Anosognosie).
Agraphie
Beeinträchtigung oder vollständiger Verlust der Schreibfähigkeit
Akinese
Bewegungsarmut; motorische Gebundenheit und Verarmung des mimischen und gestischen Ausdrucks, leiser monotoner Sprache, fehlender Mitbewegung der Arme beim Gehen, kleinschrittigem Gang und kleiner werdenden Schrift. Der Akinese liegt keine Lähmung oder Tonusstörung der Muskulatur zugrunde, vielmehr die Störung von Bewegungsautomatismen des zentralen Nervensystems.
Aktionsmyoklonus
grobe Ausschläge bei Zielbewegungen
Aktivierende Pflege
Pflege, die die Selbständigkeit des Patienten fördert
Akustische Stimulation
Anregung durch Klänge, Geräusche
Akustisch
Reizaufnahme über die Hörbahn einschließlich des Ohres.
Akutbehandlung
Sofort-, Schnellbehandlung
Alexie
Beeinträchtigung oder vollständiger Verlust der Fähigkeit zu lesen.
Amimie
Verlust oder Verarmung des Mienenspiels. Das Gesicht wirkt durch starre Mimik maskenartig.
Amnesie
Gedächtnislücke, zeitliche begrenzte Erinnerungslücke, entweder nach einem Unfall, der Bewußtlosigkeit, der Krankheit, (anterograde Amnesie) oder die Ereignisse vor dem Unfall, der Krankheit betreffend (retrograde Amnesie).
Amnestische Aphasie
Wortfindungsstörung bei sonst flüssiger Sprache
Amnestisches Syndrom
schwere Form der Merkfähigkeitsstörung
Analeptika
Das Zentralnervensystem anregende Mittel, die bei Versagen von Atmung und Kreislauf eingesetzt werden.
Anamnese
Das Erfragen der Lebensgeschichte eines Patienten oder der Vorgeschichte einer Krankheit durch den Arzt, Psychologen oder Berater.
Anarthrie
Sprechunfähigkeit, schwere Form einer zentralen Bewegungsstörung der Organe, die das Bilden von Lauten ermöglichen.
Aneurysma
sackförmige Gefäßerweiterung, häufig dünnwandig, kann deshalb leicht platzen, es kommt dann zur Hirnblutung
Angiographie
Kontrastmitteldarstellung der Hirngefäße zur Sichtbarmachung von Gefäßprozessen. Die Angiographie wird heute bei Patienten mit Kopfverletzungen nur noch selten durchgeführt. Für den Bereich der Schädel-Hirn-Verletzungen ist das risikoärmere Verfahren der Computer-tomographie an ihre Stelle getreten.
Angiom
Blutschwamm, Gefäßgeschwulst
Anopsie (auch Hemianopsie)
Teilweiser oder Gesamtausfall des Gesichtsfeldes, überwiegend zu den Seiten hin.
Anosmie
Verlust des Geruchsinnes
Anosognosie
Nicht-Beachten bzw. Leugnen von Krankheitssymptomen
Antiepileptika
Medikamente gegen epileptische Anfälle
Antikonvulsiva
Krampfhemmende Arzneimittel, die die Erregbarkeit des Gehirns gegenüber krampfauslösenden Reizen herabsetzen.
Apallisches Durchgangssyndrom
Häufig gebrauchter Sammelbegriff für Rückbildungsstadien des schweren Schädelhirntraumas mit Rückbildung motorischer und kognitiver Funktionen.
Apallisches Syndrom
Als apallisches Syndrom (persistierender vegetativer Zustand, akinetischer Mutismus, coma vigile) wird ein Krankheitsbild bezeichnet, bei dem ein Patient wach zu sein scheint, jedoch nicht in der Lage ist, mit seiner Umgebung bewußt Kontakt aufzunehmen.
Man findet das apallische Syndrom am häufigsten nach schweren Schädel-Hirn-Verletzungen, jedoch auch nach anderen Formen der Hirnschädigung (z.B. Wiederbelebung, schwere Vergiftungen). Beim apallischen Syndrom öffnet der Patient nach einer Phase der Bewußtlosigkeit wieder die Augen, nimmt jedoch keinen Blickkontakt auf. Auch Kontaktaufnahme auf anderer Ebene ist nicht möglich. Die Augen fixieren vorgehaltene Dinge nicht oder nur manchmal. Es besteht oft eine Beuge- oder Streckspastik der Extremitäten, was im weiteren Verlauf zu Versteifungen an den betroffenen Gelenken führen kann. Der Schlaf- Wachrhythmus ist nach einer Übergangsphase wieder ungestört, die sonstigen vegetativen Funktionen wie Atmung und Kreislaufregulation sind erhalten. Nahrungsaufnahme ist nur über eine Sonde möglich.
Das apallische Syndrom kann nach einer schweren Hirnschädigung eine Durchgangsform der Bewußtlosigkeit sein, aus dem der Patient zu einer weiteren Erholung fähig ist. Bei besonders schweren Hirnschäden stellt es aber auch in seltenen Fällen ein Endstadium dar, aus dem keine weitere Erholung möglich ist. Als Endstadium kann es bei guter Pflege häufig Jahre überlebt werden.
Definitionskriterien des apallischen Syndroms:
- erhaltene Spontanatmung
- erhaltener Schlaf-Wach-Rhythmus
- geöffnete Augen
- kein Fixieren
- keine sinnvolle Reaktion auf Ansprache oder Berührung
- keine eigene Kontaktaufnahme zur Umwelt
Aphasie
Sprachstörung infolge Verletzung, Blutung oder Mangeldurchblutung in einem umschriebenen Hirngebiet der dominanten Hirnhemisphäre. Äußert sich in einer Beeinträchtigung oder Aufhebung des sprachlichen Ausdruckvermögens und des Sprachverständnisses.
- Globale Aphasie – völliger Ausfall des Sprachverständisses und der Sprachwiedergabe
- Motorische Aphasie – gestörte Fähigkeit zur Sprachwiedergabe
- Sensorische Aphasie – Einschränkung des Sprachverständnisses
Apraxie
Unfähigkeit, geordnete Handlungen durchzuführen, dies betrifft auch die Gesichts-, Sprech- und Kaumuskulatur.
Arachnoidea
Spinngewebshaut (zwischen Hirnoberfläche und harter Hirnhaut).
Arterielle Kanüle
Dünner Plastikschlauch von wenigen Zentimetern Länge, der über eine Punktion in eine Schlagader (zumeist des Armes oder Beines) eingeführt wird. Zweck dieser Kanüle ist die Entnahme von Blut, aus dem u.a. die Sauerstoffsättigung des Blutes und damit der Erfolg der Beatmungsbehandlung kontrolliert wird. Über eine Leitung ist die Arterielle Kanüle mit dem Monitorsystem verbunden, so daß über sie kontinuierlich der Blutdruck des Patienten gemessen werden kann.
Arteria Basilaris
Schädelbasisschlagader, versorgt Hirnstamm und das Kleinhirn mit Blut.
Arteria Carotis
Halsschlagader, versorgt die beiden Großhirnhemisphären mit Blut.
Aspiration
Das Einatmen, auch Ansaugen flüssiger, fester oder gasförmiger Stoffe durch die Luftwege; erhöhte Gefahr der Aspiration bei Bewußtlosigkeit.
Ataxie
Koordinationsstörungen, überwiegend durch Schädigungen im Kleinhirn hervorgerufen, welche bei dem Betroffenen zur Unfähigkeit führen, zielgerichtete Bewegungen durhzuführen.
Athetose
Langsame, unwillkürliche und regellose Bewegungen der Gliedmaßen. Besonders rumpfferne Gelenke sind oft übermäßig gestreckt oder gebeugt.
Atonie
Erschlaffung, herabgesetzter Spannungszustand (Tonus) von Muskeln. Ursachen -> Muskuläre Erschöpfung.
Atrophie
Allgemein Geschwebsschwund, insbesondere aber Verschmächtigung der Muskulatur an Rumpf und Extremitäten, vor allem bei Schädigung peripherer Nerven und dadurch Lähmung, aber auch durch Schonung (Schonatrophie).
Basale Stimulation
Methode, um bei Schwerstbehinderten Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeiten anzubahnen, überwiegend durch Einsatz verschiedener Sinnesreize.
Beatmungsgerät, Ventilator
Gerät zur künstlichen Beatmung eines Patienten. Das Beatmungsgerät führt dem Patienten über den Beatmungsschlauch mit Sauerstoff angereicherte und befeuchtete Luft zu, falls die Eigenatmung des Patienten nicht ausreicht oder in der augenblicklichen Krankheitssituation nicht erwünscht ist.
Bobath-Therapie
Krankengymnastische Methode zur Behandlung cerebraler Bewegungsstörungen und halbseitiger Lähmungen von dem Neurophysiologen Karl Bobath und seiner Ehefrau, der Krankengymnastin Berta Bobath entwickelt. Zu den Behandlungsprinzipien gehört die Hemmung pathologischer Reflexe sowie der Aufbau eines normalen Haltungstonus und die Bahnung fundamentaler Bewegungsabläufe.
Cerebellum
Kleinhirn
Cerebral
Das Gehirn betreffend.
Cerebralparese
Sammelbegriff für die Folgezustände der während der Geburt oder in früher Kindheit durchgemachten Hirnschädigung, heute als Ausdruck der Mehrfachbehinderung gekennzeichnet, wobei die Bewegungsstörungen immer im Vordergrund des Erscheinungsbildes stehen.
Cerebrum
Gehirn
Coma vigile
bedeutet Wachkoma (auch Apallisches Syndrom)
Commotio cerebri
bedeutet Gehirnerschütterung
Computertomographie (abgekürzt CT)
Wichtigste Röntgenuntersuchung zur Darstellung von Prozessen innerhalb und außerhalb des Gehirns. Durch das Computertomogramm lassen sich fast alle Prozesse wie Schädelbrüche, Hirnblutungen usw. und deren Auswirkungen auf das Gehirn und einzelne Hirnteile sichtbar machen. Komplikationen nach Kopfverletzungen lassen sich so erkennen.
Contusi Cerebri
Hirnprellung
Corticoide
lebenswichtige Nebennierenrindenhormone, die unter anderem zur Behandlung einer Hirnschwellung dienen
Cystofix (suprapubischer Katheter)
Urinableitung durch ein in die Bauchdecke gelegtes Schlauchsystem
Diagnostik
Erkennung und Benennung der Krankheit
Dekubitus
Druckgeschwür bei langem Liegen, Wundliegen.
Deprivation
Zustand, in dem einem Individuum wichtige äußere Anregungen, aber auch soziale Kontakte nicht gegeben werden.
Divergenz
Ein- oder beidseitige nach außen gerichtete Abweichung der Augenachsen von der normalen Parallellage (Schielen).
Dopplersonographie
Schmerzfreies Verfahren, mittels Ultraschall Auskunft über die Durchblutung einzelner Hirngefäßabschnitte zu erhalten.
Dura
Die äußere Haut des Gehirns und des Rückenmarks.
Dysarthrie
Sprechstörung bei der Lautbildung
Dysphagie
Schluckstörung, Steckenbleiben der Nahrung in der Speiseröhre
Dysphonie
Stimmstörung mit Veränderung des Stimmklanges und Einschränkung der Stimmleistung
Ultraschallverfahren zur (schnellen) Diagnostik von Blutergüssen oder Geschwülsten im Schädelinneren (ein kaum mehr angewandtes Verfahren).
EEG (Elektroenzephalogramm)
Verfahren zur Ableitung der Hirnstromkurve. Eine derartige Ableitung geschieht über sogenannte Elektroden, die für die Dauer der Ableitung am Kopf des Patienten angebracht werden. Das EEG ermöglicht Aussagen über den Funktionszustand des Großhirns und wird insbesondere zur Überwachung bewußtloser Patienten eingesetzt.
EKG (Elektrokardiogramm)
Verfahren zur Ableitung der Herzstromkurve. Die Dauerableitung des EKG über drei am Brustkorb befestigte Klebeelektroden und die Darstellung am Monitor gehört zur Standardüberwachung des Intensivpatienten.
Embolie
In der Blutbahn schwimmendes Gerinnsel, das sich spontan nicht auflöst.
EMG (Elektromyographie)
Verfahren, um die Aktionsströme von Muskeln zu diagnostizieren. Die Aktionsströme werden dabei von der Haut oder mittels Nadelelektronen unmittelbar vom Muskel abgeleitet und nach Verstärkung in einem Kurvenbild aufgezeichnet.
Emotion, Emotionalität
Gefühl, Gemütsbewegung.
Enzephalomalazie
Zerstörung von Hirngewebe durch Gefäßverschluß.
Encephalon
Gehirn
Endokrine Drüsen
= Organe, welche Hormone in den Blutkreislauf absondern und dadurch verschiedene Vorgänge im Körper regulieren, z.B. Schilddrüse, Nebenniere, Ovar, Hoden.
Epidural
Über der harten Hirnhaut (Dural), also zwischen der harten Hirnhaut und dem Schädelknochen.
Epiduralhämatom
Blutung zwischen Schädelinnenfläche und der harten Hirnhaut
Epilepsie
Anfallsleiden.
Ergotherapie (auch Beschäftigungstherapie)
Behandlung der motorischen und kognitiven Störungen überwiegend durch den Einsatz von Werkmaterialien. Lebenspraktische Übungen, Schreibtraining, computergestützte Therapien der Aufmerksamkeits- und visuellen Störungen. Hilfsmittelversorgung.
Evozierte Potentiale
Elektrisches Testverfahren zur Funktionstestung einzelner Leistungsbahnen des Gehirns und Rückenmarks. So werden dem Patienten zum Beispiel bei der Ableitung der akustisch hervorgerufenen Potentiale Kopfhörer aufgesetzt, über die er bestimmte Schallsignale empfängt. Aus dem gleichzeitig abgeleiteten EEG lässt sich dann mit Hilfe spezieller Computersysteme herausfiltern, ob und wie schnell diese Informationen vom Gehirn verarbeitet wurde. Durch Verlaufskontrollen derartiger, den Patienten nicht belastender Untersuchungen lassen sich wesentliche Hinweise für den Verlauf und die Prognose bestimmter Verletzungsfolgen geben. Da es sich um ein sehr kompliziertes Verfahren handelt, das zudem speziell ausgebildetes Personal erfordert, steht es nicht in allen Krankenhäusern zur Verfügung.
Extension, Streckverband
Verfahren zur Aufrichtung gebrochener oder verschobener Knochen durch Zug. Die Extension ist ein Verfahren, das immer dann angewendet wird, wenn die sofortige Stabilisierung eines Bruchs durch Operation oder Gipsverband noch nicht möglich ist. Die Extension findet vorwiegend an den Beinen oder auch am Kopf zur Stabilisierung und Einrenkung von Halswirbelbrüchen Anwendung.
Siebter Hirnnerv (Nervus facialis), der die mimische Gesichtsmuskulatur versorgt.
Facialislähmung
Lähmung der vom Nervus facialis innervierten Gesichtsmuskulatur durch Schädigung des Nerves selbst, vor allem in seinem Verlauf an der Schädelbasis, mit fehlendem Stirnrunzeln, fehlendem Augenschluß und Schwäche der Wangen- und Mundmuskulatur einer Gesichtshälfte (periphere Facialislähmung). Auch durch Schädigung der zentralen Bahnen des Nervus facialis im Gehirn selbst mit nur Lähmung des Mundwinkels auf der Gegenseite der Schädigung im Gehirn (zentrale Facialislähmung).
Facio-orale Therapie (FOT)
Gesicht und Mundhöhle betreffende Behandlung.
Fokal
von einem Krankheitsgebiet ausgehend, ihn betreffend, auf bestimmte Gebiete begrenzt.
Fokus
Herd. Sitz eines lokalen Krankheitsprozesses, der über die direkte Umgebung hinaus eine pathologische Fernwirkung auslösen kann.
Fraktur
= Bruch
Frontal
Hier: die Stirnregion/das Stirnhirn betreffend.
Frontalhirn
Stirnhirn
Fronto-basale Fraktur
Schädelbasisbruch im Stirnhirnbereich
Magenspiegelung
Großhirn
Ist im wesentlichen für alle bewußten Empfindungen, Handlungsabläufe und Steuerungen des Körpers verantwortlich, ferner Wachheit und Aufmerksamkeit.
Bluterguß in Weichteilen und Zwischengewebsräumen.
Haptisch
Den Tastsinn betreffend.
Hemianopsien
Ausfall einer Gesichtsfeldhälfte
Hemiparese
Leichte halbseitige Lähmung, unvollständige Lähmung einer Körperhälfte.
Hemiplegie
Lähmung einer ganzen Körperhälfte, fast immer durch Herderkrankungen oder Verletzungen im Gehirn bedingt.
Hippotherapie
Reittherapie, Förderung normaler Bewegungen auf speziell ausgebildeten Pferden.
Hirnatrophie
Rückbildung von Gehirngewebe infolge von gestörter Sauerstoffversorgung oder mangelnder Energiezufuhr.
Hirndruckmessung
Wichtiges Verfahren zur kontinuierlichen Überwachung und gezielten Behandlung des erhöhten Druckes im Schädelinneren. Hirndruckmessungen werden – je nach Meßort – als epiDurale, subDurale oder Ventrikeldruckmessung oder als Hirngewebsdruckmessung bezeichnet.
Hirninfarkt
Schlaganfall durch Gefäßverschluß.
Hirnkontusion
Hirnprellung (Contusio cerebri), gedeckte Hirnverletzung.
Hirnödem
Krankhafte Flüssigkeitsansammlung im Gehirn, dadurch Drucksteigerung und Sauerstoffmangel.
Hirnstamm
Teil des Großhirns, wichtige Steuerungsfunktionen sind dort untergebracht, liegt zwischen den Großhirnhemisphären und dem Rückenmark
Hydrocephalus
Wasserkopf, Ansammlung von Flüssigkeit in den Hirnkammern und an der Oberfläche des Gehirns, oft mit Verlust von Hirnzellen verbunden.
Hypoxie
Sauerstoffmangel in den Geweben
Hypersensibilität
Überempfindlichkeit gegen Sinnesreize.
Hypertonie
Spannungszunahme in Geweben (z.B. Muskeln) oder Hohlraumwanderungen (z.B. Augeninnern, Gehirndruck) auch Bezeichnung von Bluthochdruck.
Hyperventilation
Über den Körperbedarf hinausgehende Beschleunigung oder Vertiefung der Atmung. Ursache ist z.B. Sauerstoffmangel.
Hypophyse
Hirnanhangsdrüse
Hyposensibilität
Verminderte Empfindlichkeit gegen Sinnesreize (z.B. herabgesetzte Schmerzempfindlichkeit).
Hypotonie
Muskelerschlaffung mit Kontraktionsbehinderung oder – unfähigkeit.
Hypoxisch
auf Sauerstoffmangel beruhend
Hypothalamus
Unterhalb des Thalamus gelegener Teil des Zwischenhirns. Funktionen: Regulation des Wäremehaushaltes, des Wach- und Schlafrhythmus, des Bluthochdrucks und der Atmung. Zentrum für Nahrungsaufnahme, Fettstoffwechsel, Wasserhaushalt, Sexualfunktion und Schweißsekretion.
Aus der ärztlichen Diagnose sich ergebende Veranlassung. Grund, ein bestimmtes Heilverfahren anzuwenden oder ein Medikament zu verabreichen.
Infusion
Zufuhr von Flüssigkeit in ein Blutgefäß. Bei Patienten mit Schädel-Hirn-Verletzungen zumeist als intravenöse Infusion in eine Körpervene über einen Venen-Katheter durchgeführt.
Infusionspumpe
Dosierungsgerät, über das stark wirksame Medikamente kontinuierlich präzise dem Patienten zugeführt werden können.
Inkontinenz
Unvermögen, Harn oder Stuhlgang zurückzuhalten
Interdisziplinär
= fachübergreifend
Intracerebrale Blutung
= Blutung in die Hirnsubstanz
Intrakranielle Blutung
= Blutung im Schädelinnenraum
Intubation
Einführung eines Schlauches zur Beatmung in die Luftröhre entweder durch den Mund oder in die Nase
Irreversibel
= nicht rückgängig zu machen
Ischämischer Hirninfarkt
durch Mangeldurchblutung des Hirngewebes bedingter Schlaganfall
Haarfein, kleinste Blutgefäße (Haargefäße) betreffend.
Katheter
Allgemeine Bezeichnung für biegsamen Plastikschlauch.
Kernspintomographie
Kompliziertes diagnostisches Verfahren zur schichtweisen Darstellung von Gewebsstrukturen mit Hilfe eines Magnetfeldes und Computereinsatz.
Kinästhesie
Bewegungsgefühl, Wahrnehmung von Stellung, Bewegung, Gewicht und Widerstand der einzelnen Körperteile wie Rumpf oder Extremitäten.
Kleinhirn
Der in der hinteren Schädelgruppe unterhalb der Hinterhauptlappen des Großhirns gelegene Teil des Gehirns. Mitwirkung bei der Aufrechterhaltung des normalen Tonus der Skelettmuskulatur und des Körpergleichgewichtes, Regulierung und Koordinierung der Bewegunsabläufe.
Klonus
- Schüttelkrampf mit schnellen, ruckartigen Muskelkontraktionen, krampfartiges Zucken.
- Durch plötzliche Dehnung auslösbare, längere Zeit anhaltende, rhythmische Muskelkontraktionen.
Kognitive Störungen
= die Wahrnehmung betreffende Störung
Koma
= Zustand tiefer, durch keinen äußeren Reiz zu unterbrechender Bewußtlosigkeit
Kontinenzfähigkeit
Fähigkeit, Urin- und Stuhlabgang zu steuern.
Kontraktur
= Versteifung und Fehlstellung eines Gelenkes mit Bewegungseinschränkung
Kontusionsblutung des Gehirns
= durch eine Schädel-Hirn-Verletzung ausgelöste Hirnblutung
= Verletzung oder Funktionsschädigung
Laryngoskopie
Kehlkopfspiegelung
Limbisches System
Randgebiet zwischen Großhirn und Gehirnstamm, das die hormonale Steuerung und das vegetative Nervensystem beeinflusst und von dem gefühlsmäßige Reaktionen auf Umweltreize ausgehen.
Linguistik
= Sprachwissenschaft
Logopädie/Sprachtherapie
Logopädie bedeutet die Diagnostik und Behandlung von Stimm-, Sprech- und Sprachstörungen mit wissenschaftlich gesicherten Methoden. Ziel ist es, die gestörte Kommunikationsfähigkeit zu verbessern.
Luftröhrenschnitt, Tracheotomie
Operationsverfahren, durch das der Beatmungsschlauch (Tubus) eines beatmeten Patienten unterhalb der Stimmbänder verlagert wird. Die Anlage eines Luftröhrenschnittes kann z.B. bei Langzeitbeatmung oder auch bei schweren Brüchen im Kieferbereich erforderlich sein.
= Mittelhirn
Mobilisation
Behandlung, mit der festsitzende oder unbeweglich gewordene Teile frei beweglich gemacht werden, auch Bezeichnung für den Übergang von der Bettlägrigkeit zum Aufstehen des Patienten.
Monitor
Zentrale Überwachungseinheit des Patienten. Am Monitor laufen alle die zur Überwachung relevanten Daten, welche kontinuierlich erfasst werden (verschiedene Drücke, Körpertemperatur, EEG, EKG) zusammen und werden graphisch dargestellt. Das Monitorsystem ist ferner in der Lage, beim Über- und Unterschreiten kritischer Grenzwerte einen akustischen Alarm zu geben und so die Überwachung des Patienten zu unterstützen.
Motorik
= Gesamtheit der willkürlichen, aktiven Muskelbewegungen
Muskelrelaxantien
muskelentspannende Medikamente
Mutismus
Unfähigkeit zur Lautbildung bzw. Tonbildung.
5. Hirnnerv
Neurochirurgie
= Spezialgebiet der Chirurgie, das alle operative Eingriffe am Zentralnervensystem umfaßt
Neuropathologie
= Lehre von den Krankheiten des Nervensystems
Neurophysiologie
= Lehre von den Funktionszusammenhängen des Nervensystems
Nystagmus
= Augenzucken
Das Hinterhaupt/den Hinterhauptslappen des Gehirns betreffend.
Ophthalmologie
= Augenheilkunde
Orthopädie
= Lehre von der Erkennung und Behandlung der Fehler der Haltungs- und Bewegungsorgane
Orthoptik
= Behandlung zur Verbesserung der Wahrnehmungsleistung des Auges
= Ernährung durch Infusionen
Paraparese
Lähmung beider Beine.
Parenchym
Parenchym ist das für ein bestimmtes Organ spezifische Gewebe, das die organtypischen Aufgaben funktionell übernehmen kann. Es wird von Binde- und Stützgewebe unterschieden, die für die Form der Organe und den gegenseitigen Halt zuständig sind.
Parese
= Lähmungserscheinungen
Pathophysiologie
Lehre von den krankhaften Lebensvorgängen und gestörten Funktionen im menschlichen Organismus.
PEG = perkutane endoskopische Gastrostomie
= Ernährung durch eine dauernd direkt in den Magen eingeführte Sonde
Phoniatrie
= Teilgebiet der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, das sich mit den kankhaften Erscheinungen bei der Sprach- und Stimmbildung beschäftigt
Physiotherapie (Krankengymnastik)
Behandlung der unfallbedingten Störungen der bewussten und unbewussten Bewegungsfähigkeiten, vor allem der Rumpfkontrolle, der Willkürmotorik und der Gehfähigkeit, Abbau der erhöhten Muskelspannung, Spastik, Behandlung von Koordinationsstörungen, besondere Verfahren (z. B. nach Bobath, Voijta, PNF u.a.)
Plegie
Völliger Ausfall der motorischen Fähigkeiten.
Pleura
Die Pleura (v. grch. pleurá Körperseite) ist ein dünne Schleimhaut, die die Lunge überzieht und den Brustkorb innen auskleidet.Die Pleura besteht aus
Rippenfell (= Pleura parietalis) und Lungenfell (= Pleura vizeralis). Auch das Zwerchfell wird von der Pleura überzogen. Zum Zwerchfell wird allerdings meist der Zwerchfellmuskel mit dazugezählt.
Funktion der Pleura
- Gleitschicht der Lunge
- Aufdehnung der Lunge durch den Sog des Brustkorbes
Krankheiten der Pleura
- Pleuritis = Rippenfellentzündung
- Pleuraerguß
- Pleuraempyem = Vereiterung im Pleuraraum
- pleurale Tumoren z.B. Pleuramesotheliom bei Asbestarbeitern
- pleurale Metastasierung von Tumoren insbesondere des Brustkrebses
- Pneumothorax
Pleuradrainage
Dicker Plastikschlauch, der z. B. bei Lungenverletzungen zwischen Rippen und Lungenoberfläche vorgeschoben wird, um Luft und Blut aus diesem Bereich abzusaugen. Die Pleuradrainage endet in einem Behälter, der sich unterhalb des Patienten befindet (Fussboden oder am Bett aufgehängt) und oft an ein Unterdrucksystem angeschlossen ist.
Pneumonie
= Lungenentzündung
Polytrauma
Mehrfachverletzungen von mindestens zwei Körperregionen oder Organsystemen, deren Schweregrad aufgrund einer gravierenden Einzelverletzung oder durch das Zusammenwirken mehrerer Schädigungen lebensbedrohlich ist. Häufigste Ursache sind Verkehrsunfälle. Es überwiegen Schädel- und Hirn-, Brust- und Bauchverletzungen. Ein Polytrauma erfordert sofortige intensivmedizinische Behandlung.
Prophylaxe
Vorbeugung und Verhütung von Krankheiten.
Psychomotorik
Die Gesamtheit der willkürlich gesteuerten, bewusst erlebten und von psychischen Momenten geprägten Bewegungs- und Handlungsabläufe.
Psychopharmaka
= zusammenfassender Begriff für veschiedene Arzneimittel, die eine steuernde (dämpfende, beruhigende, stimulierende etc.) Wirkung auf die psychischen Abläufe im Menschen ausüben
Psychosomatik
Lehre von den Beziehungen zwischen Körper und Seele sowie seelisch-geistiger (Mit-)Ursachen von Erkrankungen.
Pulsoxymeter
Gerät zur Messung der Pulsfrequenz und des Sauerstoffgehaltes im Blut; gemessen wird mit Hilfe eines Finger- oder Stirnsensors.
= Wiederbelebung
Reflex
Unwillkürliche Reaktion durch einen äußeren Reiz, z.B. Zusammenziehen eines Muskels.
Regression
Zurückgehen auf frühe, speziell kindliche Verhaltensweisen; der Betroffene reagiert in Konfliktsituationen seinem Alter unangemessen.
Rehabilitation (medizinisch)
= gezielte therapeutische Maßnahmen (z.B. Krankengymnastik, Sprach-, Arbeits- und Beschäftigungstherapie) zur Wiederherstellung der geistigen und körperlichen Funktionen
Remission
= Rückbildung (z.B. von Krankheitszeichen)
Retrograde Amnesie
= über den Zeitpunkt des Schädigungsereignisses zurückführende Gedächtnislücke
Reversibel
= umkehrbar, heilbar
= medikamentöse Dämpfung und Beruhigung eines Kranken
Sensomotorische Defizite
= Mängel in der Gesamtaktivität beim Fühlen und Bewegen
SHT (= Abkürzung für Schädel-Hirn-Trauma), Schädel-Hirn-Verletzung
Verletzung von Kopfschwarte, knöchernem Schädel und Gehirn durch Einwirkung äußerer Gewalt, meist mit schweren Komplikationen verbunden. In Abhängigkeit vom Schweregrad wurde das SHT früher Commotio cerebri (Gehirnerschütterung), Contusio cerebri (Hirnprellung) oder Compressio cerebri (Hirnquetschung) genannt. Man unterscheidet nach gedecktem oder offenem SHT und bezeichnet den Schweregrad bezogen auf die Dauer der Bewußtlosigkeit.
Snoezelen
Snoezelen ist eine ausgewogen gestaltete Räumlichkeit, in der durch harmonisch aufeinander abgestimmte multisensorische Reize Wohlbefinden und Selbstregulationsprozesse bei den Anwesenden ausgelöst werden. Durch die speziell auf die Nutzer hin orientierte Raumgestaltung werden sowohl therapeutische und pädagogische Interventionen als auch die Beziehung zwischen Anleiter und Nutzer gefördert. Snoezelen kann im Kranken-, Behinderten- und Nichtbehindertenbereich wirksam angewendet werden.
Somnolenz
= schläfriger Zustand, aus dem der Patient durch äußere Reize erweckbar sind
Sonographie
= Ultraschalldiagnostik
Spasmus/Spastik
= durch eine Hirn- oder Rückenmarksschädigung ausgelöste Steigerung oder Muskelspannung
Spinal
Zur Wirbelsäule, zum Rückenmark gehörend.
SSEP (somatosensibel evozierte Potentiale)
Untersuchungsmethode zum Nachweis von Schäden bestimmter Nervenbahnen im Rückenmark und im Gehirn.
Stimulation
= Anregung
Stimulus
= Reiz
Subarachnoidal-Blutung
= Blutung im Nervenwasserraum
Subdural
Unterhalb der harten Hirnhaut gelegen zwischen der harten Hirnhaut und der dem Hirn anliegenden Spinngewebshaut.
Subduralhämatom
= durch Verletzung entstandene Blutung zwischen der harten Hirn- und Spinngewebshaut
Symptom
= Krankheitszeichen
Syndrom
= Krankheitsbild aus verschiedenen charakteristischen Krankheitszeichen
= gleichzeitige Lähmung an allen vier Gliedmaßen
Tetraspastik
= Erhöhung der Muskelspannung bei allen vier Extremitäten
Thalamus
größte, graue Kernmasse des Zwischenhirns.
Thromboembolie
Embolie infolge eines verschleppten Blutgerinnsels, meist vom Herzen ausgehend.
Trachea
Luftröhre
Tracheakanüle
Dünne Sonde, die nach Eröffnung der Luftwege im unteren Teil des Kehlkopfes die Verbindung nach außen aufrecht erhält und eine künstliche Beatmung ermöglicht.
Tracheostoma
Durch Luftröhrenschnitt entstehende Öffnung der Atemwege unterhalb des Kehlkopfes.
Tracheotomie
= Luftröhrenschnitt
Tranquilizer
Psychopharmaka mit angstlösender, beruhigender und entspannender Wirkung, daher Anwendung bei Verstimmungs- und Angstzuständen sowie Schlafstörungen.
Transducer
Englisches Wort für Druckaufnehmer. Druckaufnehmer sind kleine, druckempfindliche Überwachungsgeräte, über die kontinuierlich wichtige Drücke (Hirndruck, Blutdruck, etc.) erfasst und an das Monitorsystem weitergeleitet werden.
Transnasal
Durch die Nase.
Trauma
Verletzung des Körpers durch Gewalteinwirkung
Traumatisch
Durch Verletzung entstanden.
Thromboembolie
= akuter Gefäßverschluß infolge eines verschleppten Blutgerinnsels
Thrombolyse
=Auflösung eines Blutgerinnsels
Tonus
= Spannung
Dünner Plastikschlauch, über den der Urin des Patienten in ein Sammelgefäß geleitet wird.
Urologie
= Fachgebiet für Krankheiten der Harnorgane
= autonomes, gegenüber dem Zentralnervensystem weitgehend selbständiges Nervensystem, das mit weitverzweigten Nervenfasern und -zellen die Lebensfunktionen des Körpers regelt
Venenkatheter, Zentralvenenkatheter, ZVK
Dünner Plastikschlauch, über den die künstliche Ernährung und die Zufuhr von Medikamenten in das Blutgefäßsystem erfolgt. Derartige Katheter werden entweder am Arm, unterhalb des Schlüsselbeins am Brustkorb oder in der seitlichen Halsgegend angebracht.
Ventrikeldrainage
Wenn der Abfluss des Liquors (Gehirnwasser) aus den Hohlräumen des Gehirns (Ventrikel) aus irgendeinem Grund blockiert ist und der Druck daher im Gehirn zu groß wird macht man eine Shunt-Operation, um die Ventrikel zu drainieren, d.h. eine Abflußmöglichkeit des Liquors aus dem Ventrikel, z.B. in die obere Hohlvene (Vena Cava).
VEP (Visuell evozierte Potentiale)
Untersuchungsmethode zum Nachweis von Schäden der Sehbahn und der Sehrinde des Gehirns durch Darbietung von Sehreizen.
Vestibulartraining
Gleichgewichtstherapie
Vigilanz
= Wachheit; Fähigkeit, Aufmerksamkeitsleistung über längere Zeit zu erbringen.
Vitalfunktion
= lebenswichtige Funktion
Volumenmangel
Volumenmangel bedeutet, dass die Einfuhr an Flüssigkeit, die Ausfuhr (Harn, Stuhl, Schweiß, etc.) nicht ausreichend kompensiert, sodass es über kurz oder lang zu einem Wasserdefizit des Körpers kommt („der Patient trocknet aus“).
Vojta
Karl Vojta, Begründer einer krankengymnastischen Methode.
Laienbegriff für apallisches Syndrom.
Wahrnehmung
Aufnahme und Verarbeitung von Reizen über die verschiedenen Sinnesorgane (z.B. Augen, Ohren, Haut, Geruch, Geschmack).
Blauverfärbung vor allem der Lippen und Fingernägel bei Sauerstoffmangel im Blut.
ZNS – Zentralnervensystem
Bezeichnung für Gehirn und Rückenmark.
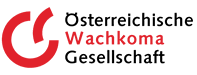
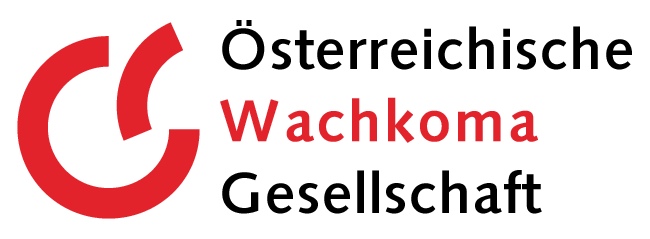 Ab sofort können Sie sich für die Jahrestagung am 17. Oktober 2025 anmelden.
Ab sofort können Sie sich für die Jahrestagung am 17. Oktober 2025 anmelden.